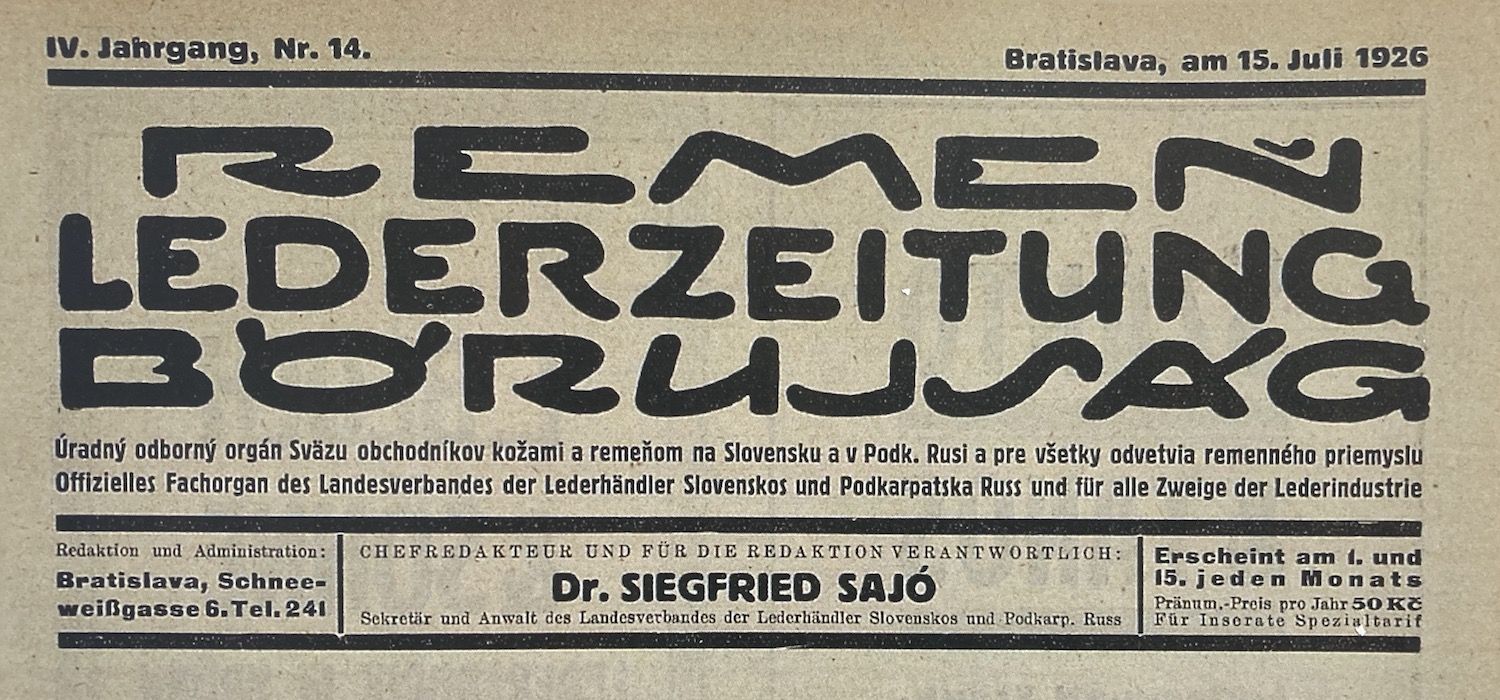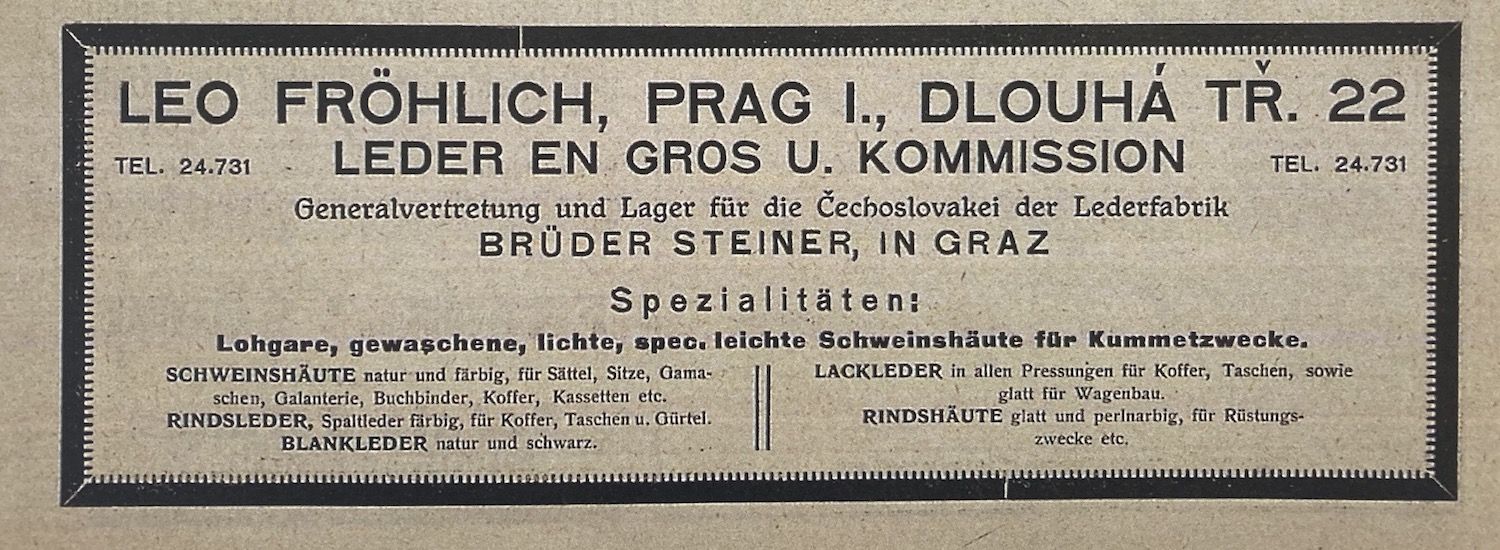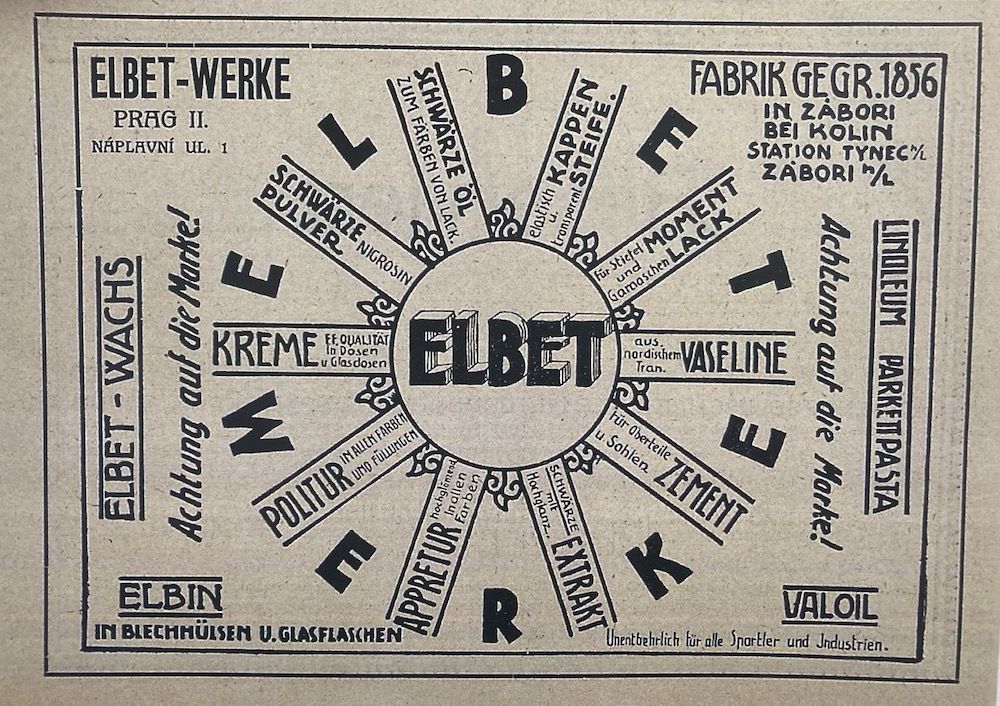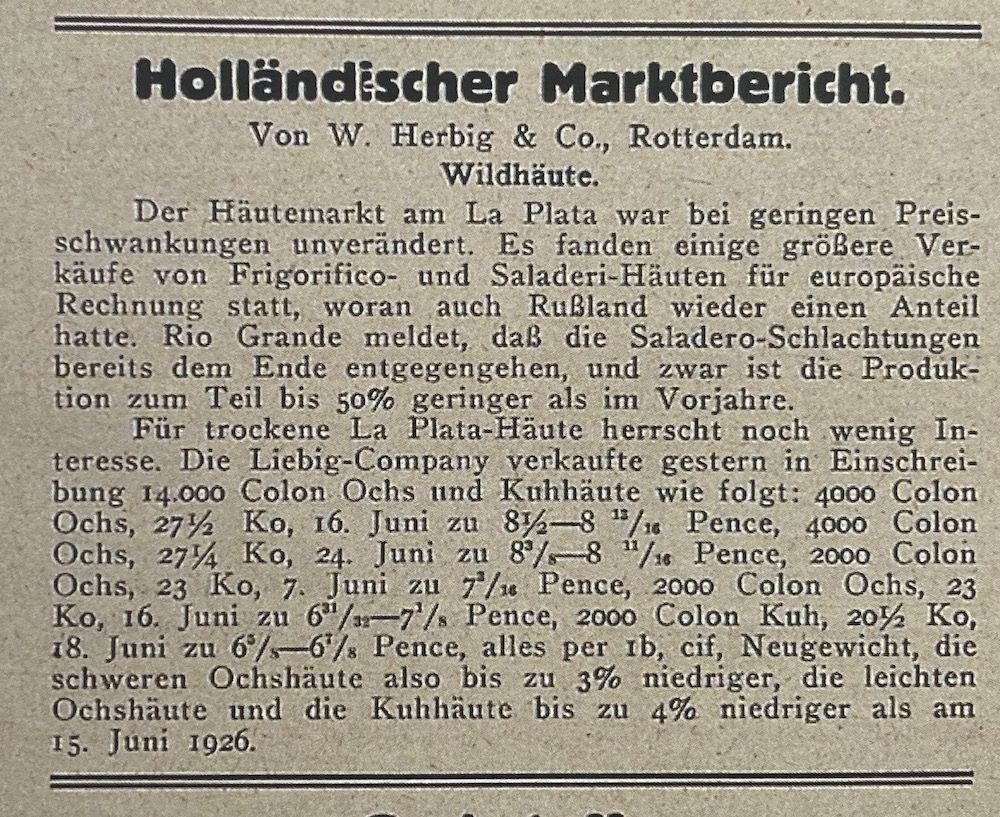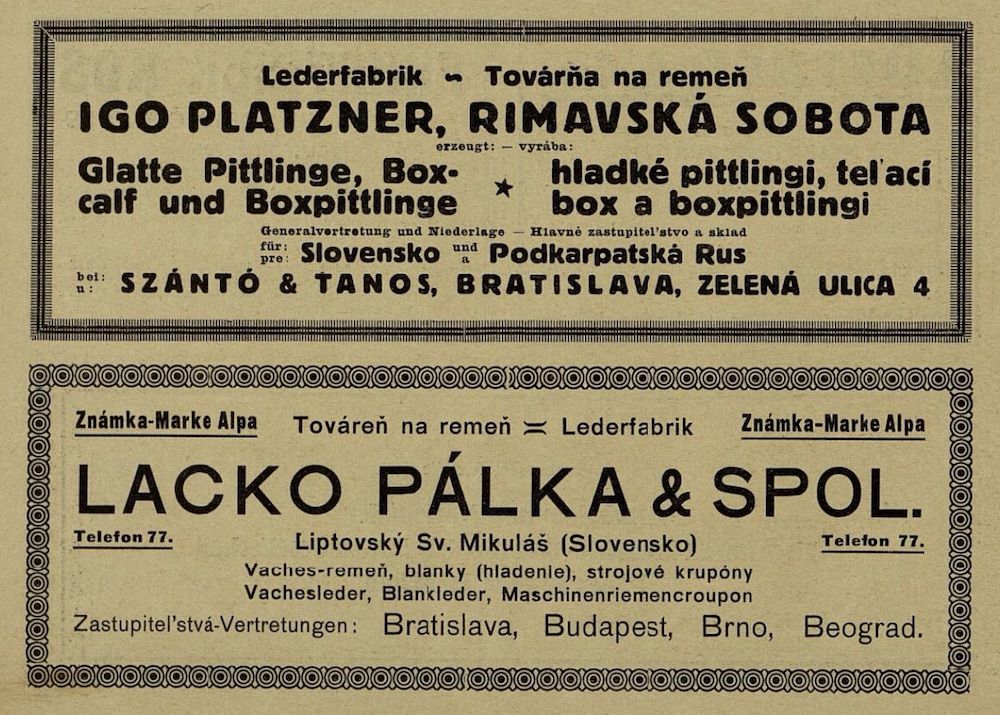Lohmühlen | Lohgerberei – Rotgerberei
Pollackmühle in Ferlach | Lohmühle
©Hans Singer
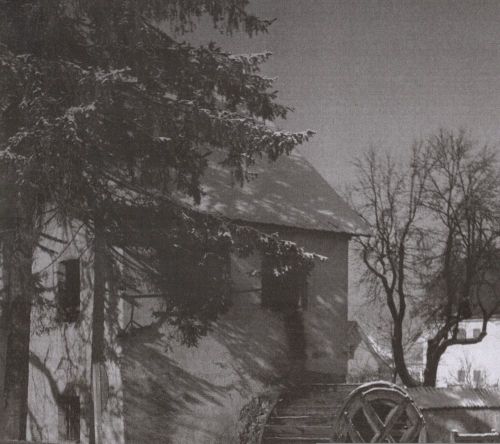
Abbau des Mühlrades der Pollackmühle in Ferlach
©Tržiški Muzej


Bild von Marica Šmid. Blick auf das Haus, in dem Jože Gros seine Kindheit verbrachte (rechts), die Harpfe, auf der man Rinde trocknete. Im Hintergrund die Lederwerkstätte Runa.
Kozolec | Harpfe in der Rinde getrocknet wurde
©Tržiški Muzej
Erinnerung des Schusters Jože Gros aus Tržič
Die Werkstätte war im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses. Im oberen Stockwerk, beziehungsweise am Dachboden, hat unsere Familie gelebt. – mein Vater und die Mutter mit drei Kindern, im ersten stock lebten die Eltern meiner Mutter – auch mit den Kindern, im Erdgeschoss war die Werkstätte. Mit uns im Haus wohnte auch einer der Helfer, der bei meinem Großvater arbeitete. Gegenüber dem Haus war ein offener Platz, wo man Rinde trocknete – Fichtenrinde, die man aus Lom und Umgebung anlieferte. Man nannte sie Lohrinde und die Gerber haben sie bei der Bearbeitung der Häute verwendet. In der Nähe war eine Mühle, wo man die Rinde gemahlen und zu Lohrinde verarbeitet hat, die die Gerber verwendeten.
Aufgezeichnet von Bojan Knific, Tržiški Muzej
Übersetzung: Petra Kohlenprath
Ferlach – Loibl – Tržič
Das Museum in Tržič widmet einen Teil seiner Dauerausstellung dem Thema Lederverarbeitung und Schuhhandwerk.
Tržiški muzej: Dauerausstellungen
Digitale Ausstellung: Werkzeuge in der Lederherstellung
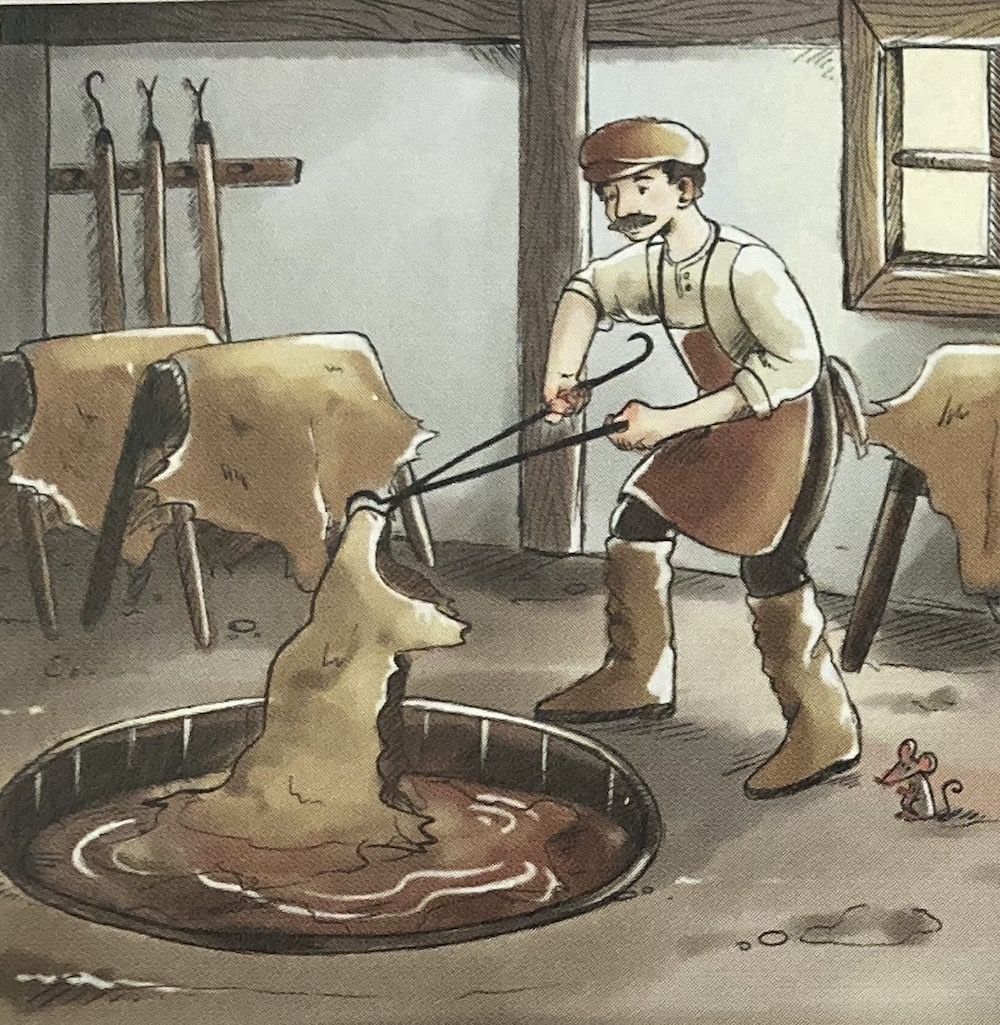

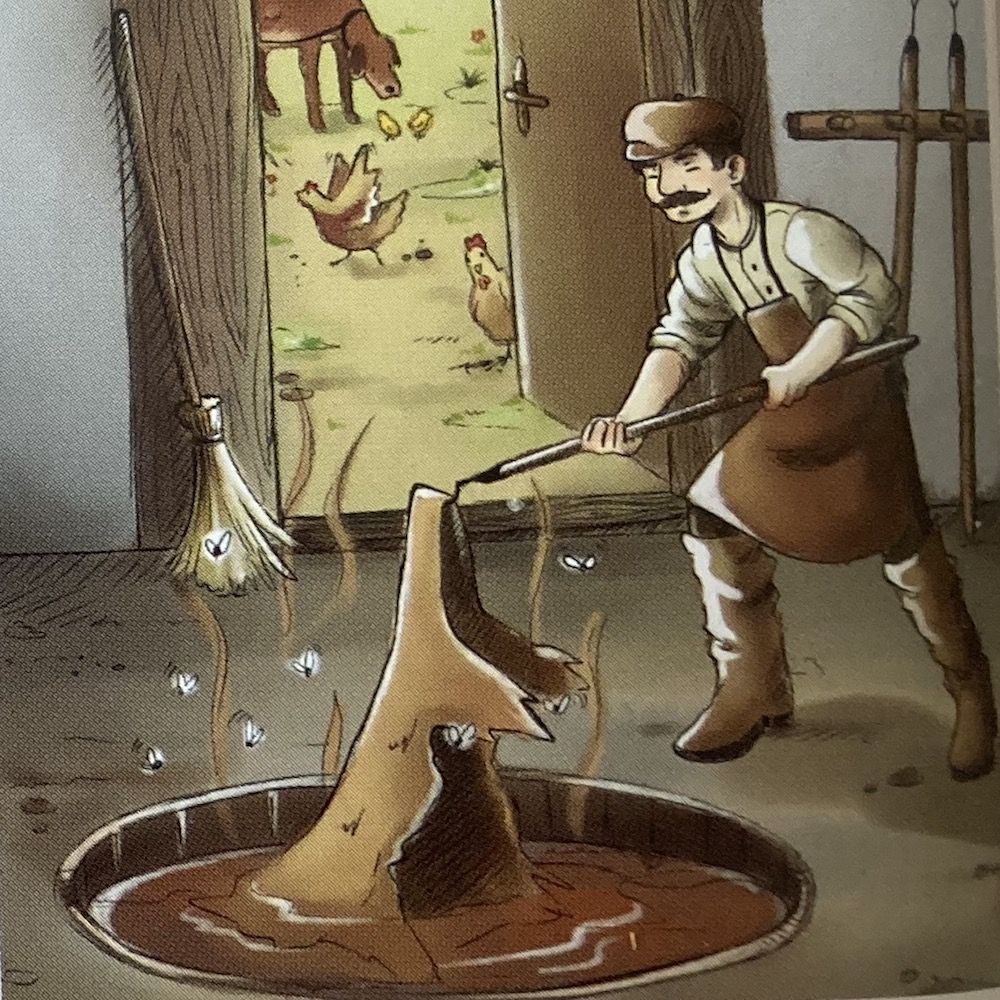
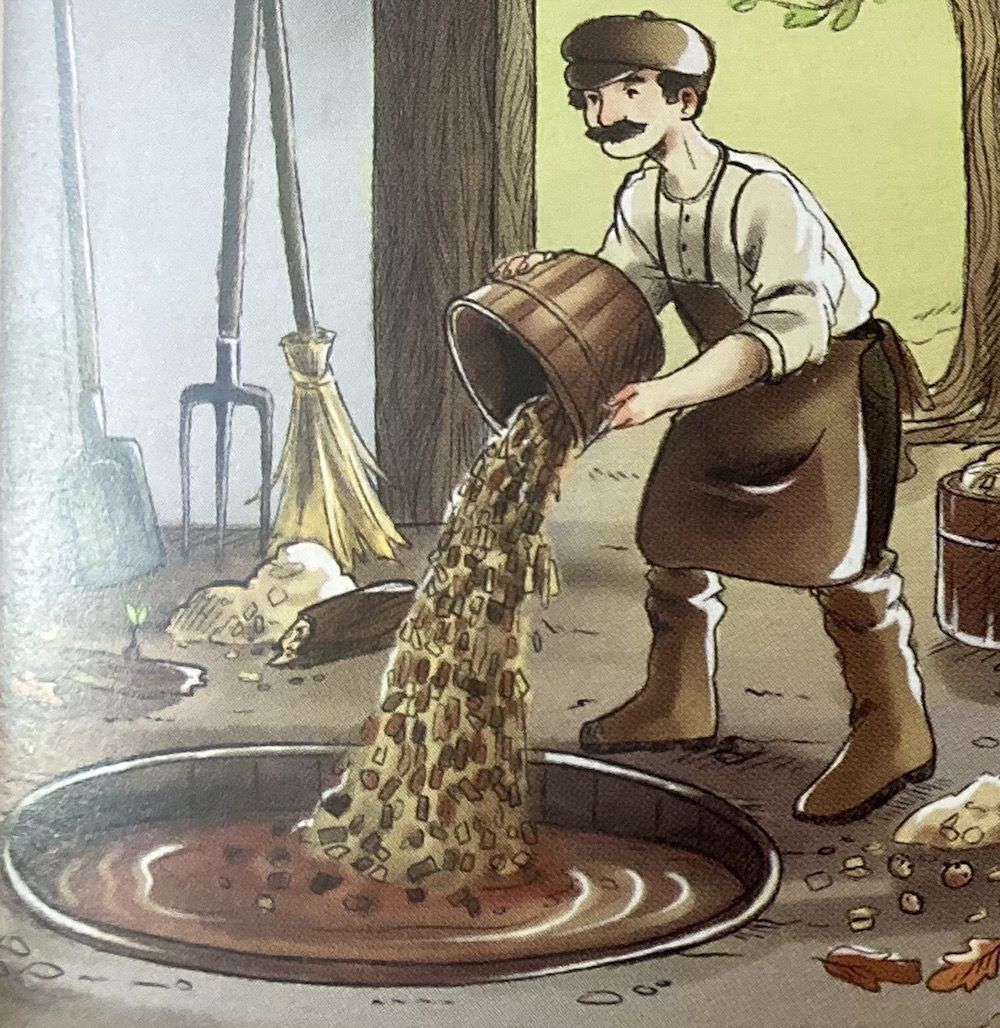
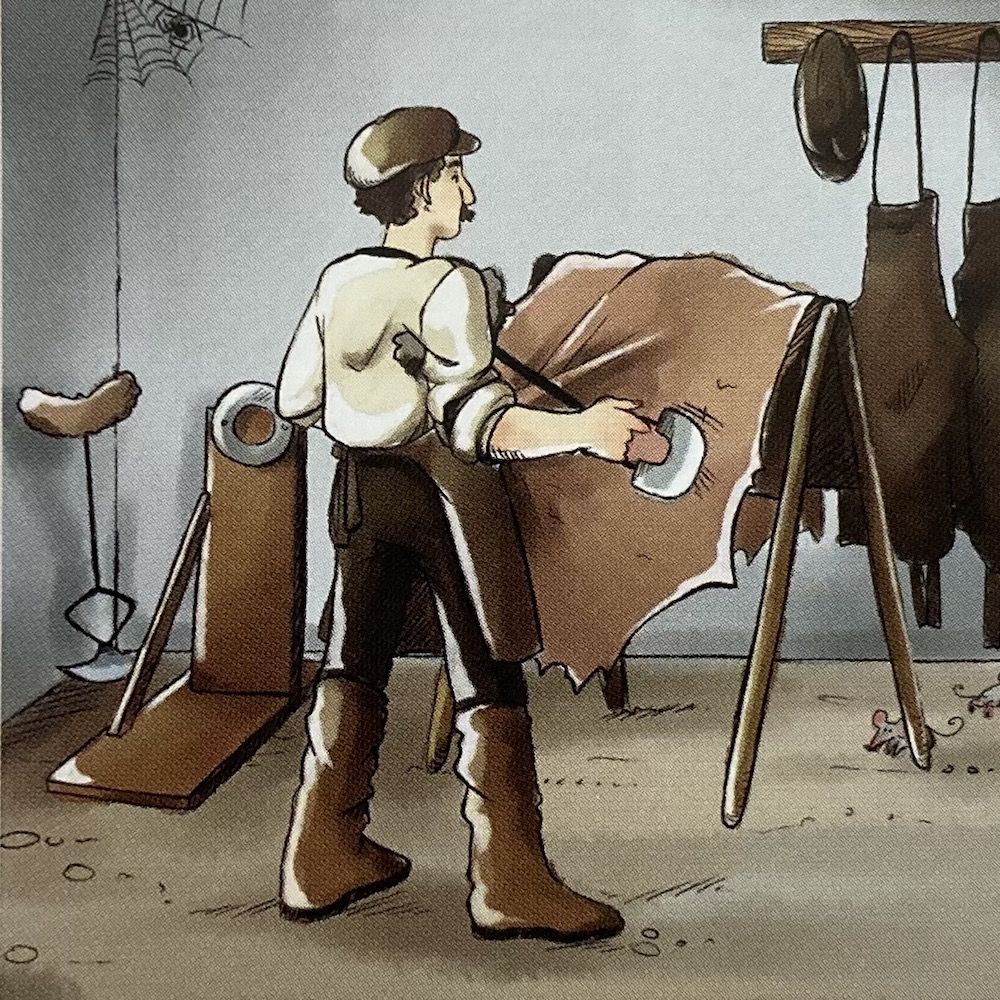
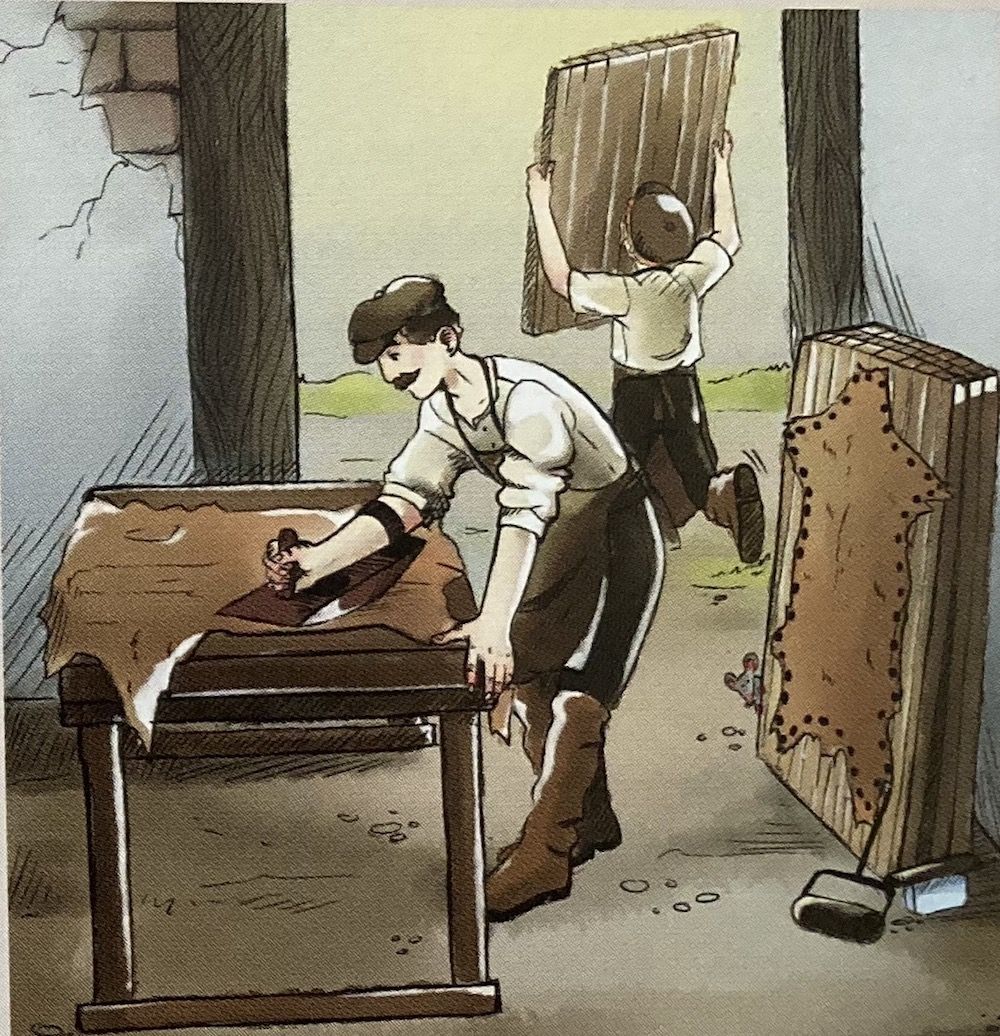
Schematische Darstellung einiger Schritte im Gerbprozess
Aus der Publikation: Usnje vseh barv
Tržiški Muzej, 2015, Usnje vseh barv, Bojan Kniflic, Eigenverlag
Zahlen Tržič
1788 wurden verarbeitet
4.800 Kalbshäute
250 Stier- und Rinderhäute
1.600 Ziegen- und Lammhäute
8.000 Schafhäute
Es gab:
14 Gerbermeister in 16 Werkstätten
Tržič
1871 wurden verarbeitet
15.000 Stierhäute
20.000 Rinderhäute
600 Kalbshäute
150.000 Schafhäute
600 Kalbshäute
4.000 Schweinshäute
100 Pferdehäute
Krems
1854 wurden in der Kremser Lederindustrie Franz Schmitt verarbeitet
15.000 Häute
25.000 Felle
wozu 8.000 Zentner Eichenlohe
und 12.000 Zentner Fichtenlohe
benötigt wurde.
Der Kremser Chronist Kienzl nennt 1869 diese Anlage als die größte Österreichs.
Mohorič Ivan
1957 Zgodovina obrti in industrije v Tržiču.
Tržič in Ljubljana: Metni Muzej Tržič,
Državna založba v Ljubljani
Gerberei Salzer, Eisenerz
um 1892
Foto: Salzer Erich
Website – Kontakt
Gerberei Salzer Museum
Eisenerz

Fotografien aus:
Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion – Forstliche Nebennutzung
von Hiltraud AST und Georg WINNER

Holzarbeiter mit dem Rindenschinder in der Längapiesting bei Gutenstein; Foto: Zwazek, um 1939.

Bei diesem Baum wurde schon vor dem Fällen ein Stück Rinde abgeschält, Ölbild, Besitz Goldbacher, Miesenbach.

Trockengestell für Lohrinde aus Stangenholz; Foto: Zwazeck um 1938.

Die angelehnten Rollen werden gegen Nässe abgedeckt; Foto: Zwazeck um 1938.

Eine sehr leichte Sommerhütte, wie das „Gleichenbäumchen“ zeigt, eben in Bau; die verwendeten
Rindenflecke sind mehr als mannshoch.
Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion – Forstliche Nebennutzung
Hiltraud AST und Georg WINNER